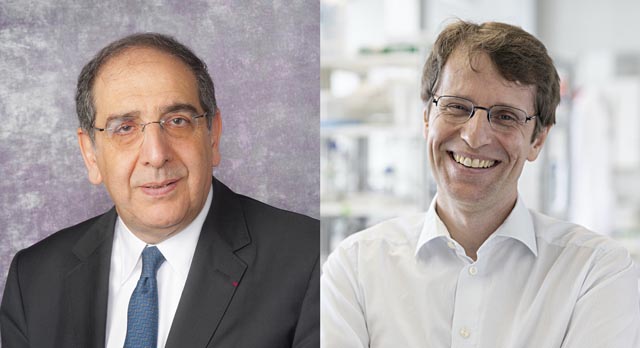(pd) Botond Roska erhält, zusammen mit seinem langjährigen Forschungspartner José-Alain Sahel, den internationalen Preis für translationale Neurowissenschaften. Der mit 60 000 Euro dotierte Preis wird von der deutschen Gertrud-Reemtsma-Stiftung, die von der Max-Planck-Gesellschaft verwaltet wird, für aussergewöhnliche Beiträge zum Verständnis der Neurobiologie und neurologischer Erkrankungen vergeben. Die Preisverleihung findet am 22. Juni 2023 in Hamburg statt.
"Wir freuen uns sehr über diese positive Anerkennung durch die neurowissen-schaftliche Gemeinschaft", sagte Botond Roska, der seit 2017 das Institut für Molekulare und Klinische Ophthalmologie Basel (IOB) leitet. «Es ist eine grosse Ehre für uns, unter den früheren Preisträgern aufgeführt zu sein - allesamt grosse Namen auf diesem Gebiet.»
Neurowissenschaftler Botond Roska ist zusammen mit Augenarzt Hendrik Scholl (Leiter der Augenklinik des Universitätsspital Basel) Gründungsdirektor des Institutes für Molekulare und Klinische Ophthalmologie Basel (IOB), das sich in den ersten fünf Jahren zu einem weltweit führenden Zentrum der Sehforschung und Therapieentwicklung für Augenkrankheiten etabliert hat. Seit 2010 ist er Professor an der Medizinischen Fakultät und seit 2019 Professor an der Naturwissenschaftli-chen Fakultät der Universität Basel.
Die aktuelle Auszeichnung unterstreicht den eingeschlagenen Forschungsweg und würdigt die bedeutende Stellung der Optogenetik im Kampf gegen die Blindheit.
Zukunftstechnologie Optogenetik
Botond Roska und José-Alain Sahel haben den Preis erhalten, in Anerkennung ihrer bahnbrechenden Arbeiten zur Wiederherstellung des Sehvermögens blinder Patienten mithilfe der optogenetischen Therapie. Die Optogenetik ist eine Methode zur Erzeugung lichtempfindlicher Zellen unter Verwendung von aus Algen gewonnenen Genen. Botond Roska war einer der Ersten, der diese Technik zur Wiederherstellung des Sehvermögens in Tiermodellen einsetzte. Nachdem seine Untersuchungen vielversprechende Möglichkeiten für die Behandlung degenerativer Netzhauterkrankungen aufgezeigt hatten, schloss sich Botond Roska mit José-Alain Sahel zusammen, der derzeit Vorsitzender und Distinguished Professor der Abteilung für Augenheilkunde an der University of Pittsburgh School of Medicine und Direktor des UPMC Vision Institute sowie Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats des IOB in Basel ist.
Mit Hilfe optogenetischer Methoden gelang es ihnen, das Sehvermögen von Patienten, die durch Retinitis pigmentosa (RP) erblindet waren, teilweise wiederherzustellen. Dies ist die erste Demonstration der Optogenetik am Menschen und ein Meilenstein in der Behandlung von Erblindungskrankheiten, von denen weltweit Millionen von Menschen betroffen sind.
Forscherpartner Botond Roska und José-Alain Sahel
Die beiden Wissenschaftler lernten sich 2001 kennen, als Botond Roska in Berkeley, USA, in Zell- und Molekularbiologie promovierte. Er kam nach Strassburg, Frank-reich, um einen Monat an der Universität Louis Pasteur zu verbringen, wo José-Alain Sahel damals Laborleiter war. Eines Nachts gelang es Botond Roska, die Aktivität einiger Netzhautzellen aufzuzeichnen, und seine ungestüme Reaktion veranlasste José-Alain Sahel, der im Obergeschoss noch immer arbeitete, nach dem Rechten zu sehen. «Plötzlich stand Dr. Sahel an der Tür und fragte: ‹Was ist hier los?›», sagt Botond Roska. «Also zeigte ich ihm meine Aufnahmen, und wir diskutierten stundenlang über die Forschung.»
So begann eine lange und komplementäre Zusammenarbeit. Indem sie defekte Photorezeptoren im Auge mit lichtsensitiven Proteinen ausstatten, hoffen die beiden, die Zellen zu reaktivieren und ihre Funktionsfähigkeit wiederherzustellen.
In ihrer Forschung haben die beiden Wissenschaftler erfolgreich Photorezeptor-Schaltkreise in blinden Labormäusen resensibilisiert, die schon bald Verhaltensänderungen in heller und dunkler Umgebung zeigten. Im Jahr 2021 berichteten die beiden Forscher und ihre Co-Autoren vom Pariser Vision Institute, das von José-Alain Sahel gegründet wurde, über verblüffende Ergebnisse einer klinischen Studie mit blinden RP-Patienten, die sich in einem frühen Stadium befanden. Obwohl die Studie durch die COVID-Pandemie unterbrochen wurde, konnte ein Patient das gesamte Studienprotokoll abschliessen.
Innerhalb weniger Monate konnte er verschiedene Gegenstände, die vor ihm auf einem Tisch lagen, erkennen und bewegen. Der daraus resultierende Artikel in Nature Medicine wurde mehr als 150'000 Mal heruntergeladen. «Dies war der erste Konzeptnachweis für die Optogenetik bei einer menschlichen Krankheit», sagt Botond Roska und fügt hinzu, dass neuere Daten aus der Studie zeigen, dass einige behandelte Patienten sogar noch bessere Ergebnisse erzielen.
«Nach vielen Jahren der Zusammenarbeit ist der Gewinn dieses Preises eine freudige Überraschung», sagt José-Alain Sahel. «Dr. Roska und ich teilen einen gemeinsamen Enthusiasmus und ein starkes Interesse an der Wissenschaft, und unsere Zusammenarbeit bringt immer wieder neue Ideen hervor. Die Optogenetik hat eine grosse Zukunft in der Augenheilkunde, und unser langfristiges Ziel ist es, sie für die Patienten noch besser zu machen.»
IOB: Institut mit Pioniercharakter
Das Institut für Molekulare und Klinische Ophthalmologie Basel (IOB) ist eine Stiftung, die 2017 gemeinsam von der Universität Basel, dem Universitätsspital Basel und Novartis gegründet worden ist. Die akademische Unabhängigkeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist in den Gründungsdokumenten sichergestellt. Das IOB lebt eine funktionierende Public-Private-Partnership und hat Modellcharakter.
Geleitet wird das IOB von Neurowissenschaftler Botond Roska und Augenarzt und Leiter der Augenklinik des Universitätsspitals Basel Hendrik Scholl. 139 Forscher und Forscherinnen aus 31 Nationen arbeiten am IOB. Im letzten Jahr veröffentlichten IOB-Wissenschaftler 147 Fachpublikationen (peer-reviewed publications) und wurden mit über einem Dutzend Preisen ausgezeichnet.
Bilder: José-Alain Sahel (links) und Botond Roska (rechts). Fotos: zVg